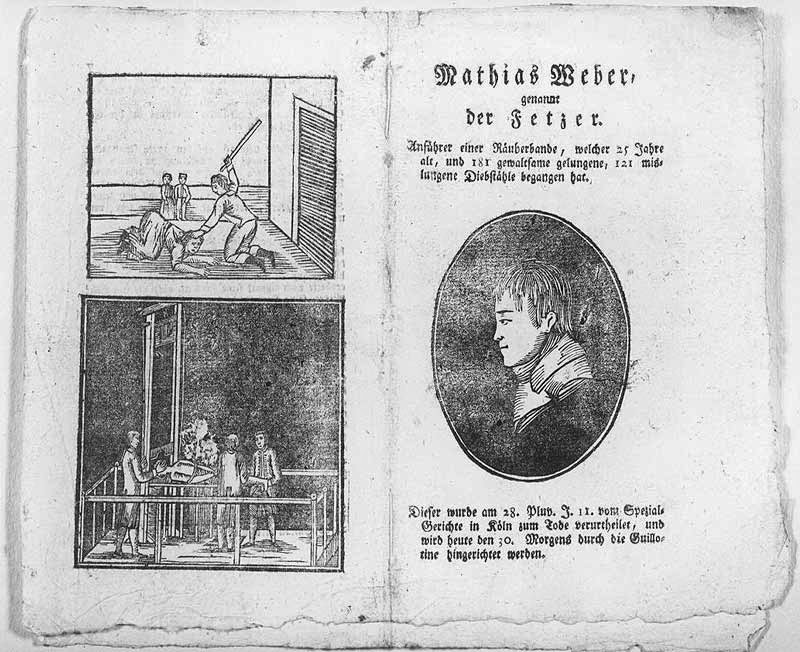Dies ist ein gekürzter Auszug aus meinem neuen Aufsatz „Bonn im Spiegel der Musik“, der Ende des Jahres in den „Bonner Geschichtsblättern“, Band 64, erscheinen wird. Dort ist auch der Originaltext des hier vorgestellten Lieds abgedruckt:
Aus dem Jahre 1928 stammt der Schlager Das war in Bonn am Rhein, der von dem bekannten Operetten-Librettisten Fritz Löhner-Beda geschrieben wurde. Die Melodie stammte von Ferry Stipschitz, über den leider nichts weiter bekannt ist. Erschienen ist es im Wiener Boheme-Verlag. In Hofmeisters musikalisch-literarischem Monatsbericht vom Januar 1929 wird es als „Lied für Gesang und Pianoforte“ erwähnt. Das Copyright ist im „Renewal Registrations-Music“ für den 10.11.1928 unter der Nummer EF1436 eingetragen. Am 10.4.1956 ging es an Bruno Löhner, den Sohn des Librettisten, über.
FritzLöhner-Beda wurde am 24.6.1883 in Wildenschwert/Böhmen geboren und studierte zunächst Rechtswissenschaften an der Wiener Universität, doch gab er 1910 seine Anstellung in einer Anwaltskanzlei auf und wurde freier Schriftsteller. Seit er 1916 für Franz Lehár das Libretto zur Operette Der Sterngucker geschrieben hatte, stieg er in den 1920er Jahren zu einem der meistgefragten Librettisten Österreichs auf. Zu seinen bekanntesten Arbeiten zählen die Libretti zu den Operetten Land des Lächelns, Schön ist die Welt und Die Blume von Hawaii. Außerdem schrieb er eine Reihe Erfolgsschlager wie In der Bar zum Krokodil, Ausgerechnet Bananen, Ich hab’ mein Herz in Heidelberg verloren, Oh, Donna Clara und Dein ist mein ganzes Herz. Am 13.3.1938, einen Tag nach der Annexion Österreichs, wurde Löhner-Beda wegen seiner jüdischen Herkunft verhaftet und zunächst ins KZ Dachau und dann nach Buchenwald verschleppt, wo er Ende 1938 den Text für das Buchenwald-Liedverfasste. 1942 folgte sein Transport in das Vernichtungslager Auschwitz, wo er am 4. Dezember verstarb.
Das Lied wäre heute sicherlich ganz vergessen, hätte es nicht in den Jahren 1967–1972 eine von der ARD in zehn Folgen ausgestrahlte Koproduktion von WDR und RIAS mit dem Titel „Opas Schlagerfestival“ gegeben, in der auch dieses Stück aufgeführt wurde. Die Leitung der Produktion lag in den Händen von Ernst Kalthoff und Hans Rosenthal, der auch als Conferencier durch die Sendung führte. Aufgezeichnet wurde vor Saalpublikum in Berlin, Bad Salzuflen, Stuttgart, Leverkusen, Lünen und Bad Godesberg (damals noch eigenständig). In jeder Sendung wurden Schlager und Operettenmelodien eines bestimmten Jahrgangs (1926–1932) von unterschiedlichen Interpreten – darunter so bekannte Größen wie Loni Heuser, Fred Bertelmann, Bill Ramsey, Willy Schneider, das Medium-Terzett und René Kollo – vorgestellt. Am Ende kürte eine Jury durch Punktevergabe den Siegerschlager. Die musikalische Leitung hatte Heinrich Riethmüller.
Am 24. Oktober 1968 wurde die 3. Folge dieser Sendung, die sich auf das Jahr 1928 bezog, in der Godesberger Stadthalle aufgenommen. Mitwirkende waren: Dorothea Chryst, Undine von Medvey, Rita Paul, Tatjana Sais, Edith Schollwer, Fred Bertelmann, Ekkehard Fritsch, Bruno Fritz, Werner Hass, Andreas Mannkopff, Willy Schneider, Günther Schwerkolt und die Rosy-Singers. Es spielte das RIAS-Tanzorchester unter Dave Hildinger; an zwei Flügeln saßen Günter Neumann und Heinrich Riethmüller. Als Besonderheit sang Willy Schneider das hier vorgestellte Lied
Das war in Bonn am Rhein, allerdings mit einem stark veränderten Text. Auf einer sehr seltenen Aufnahme eines privaten Mitschnitts hört man noch die Begeisterung des Publikums, das den Vortrag mehrmals durch Klatschen und Lachen begleitet. Die Aufnahme wurde mir freundlicherweise von Dr. Burkhard Fehse (
http://www.fehse-online.de/) zum Posten überlassen. Herzlichen Dank dafür!
Das war in Bonn am Rhein (mit verändertem Text für die RIAS-Aufnahme)
Ich weiß ein kleines Städtchen im schönen deutschen Land,
so manches hübsche Mädchen hab ich dort gut gekannt.
Die kleinen alten Gassen, die waren mir nicht gram,
wenn ich mal ausgelassen des Nachts nach Hause kam.
Man sang und populierte, man machte manchen Streich,
man liebte und studierte. Wie hieß das Städtchen gleich?
Das war in Bonn am Rhein, in Bonn am Rhein zur Frühlingszeit.
Es schien die Sonn’ am Rhein, die Sonn’ am Rhein voll Herrlichkeit.
Ich mag die Großstadt nicht, die lärmend schrille laute Welt.
Viel schöner ist doch die verträumte stille traute Welt.
Da lob’ ich Bonn am Rhein, das Städtchen klein mit gold’nem Wein.
Da blieb die Zeit noch sten’n, da kann man so romantisch sein.
Und wünscht man sich mit der Vergangenheit ein Stelldichein,
da gibt’s ein Städtchen nur und das ist Bonn am Rhein.
Das war vor 30 Jahren, ich stand grad am Beginn,
und nun mit weißen Haaren fuhr ich noch einmal hin.
Und als ich kam geschlendert, da wurde mir bald klar:
Bonn hat sich nicht verändert, es blieb so wie es war.
Die Häuser klein und niedlich, die Menschen ohne Streit
und alles so gemütlich wie in der Jugendzeit.
Das war in Bonn am Rhein, in Bonn am Rhein zur Frühlingszeit.
Es schien die Sonn’ am Rhein, die Sonn’ am Rhein voll Herrlichkeit.
Ich mag die Großstadt nicht, die lärmend schrille laute Welt.
Viel schöner ist doch die verträumte stille traute Welt.
Da lob’ ich Bonn am Rhein, das Städtchen klein mit gold’nem Wein.
hier blieb die Zeit noch sten’n, hier kann man so romantisch sein.
Oh, bleib in aller Zukunft immer unser Sonnenschein,
du wunderschönes kleines Städtchen Bonn am Rhein!